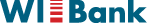„Ich ruf da jetzt an und höre mal, wie es geht"
Nina Gibbert-Doll, Förderberaterin der WIBank, konnte Familie und Beruf im Lockdown vereinbaren – und wünscht sich trotzdem den Büroalltag zurück. Im Interview erzählt sie von ihren Homeoffice-Erfahrungen und wie ihr Gärtnern beim Abschalten hilft.
Im Frühjahr letzten Jahres, zu Beginn des ersten Lockdowns, habe ich einige Zeit noch vor Ort im Büro gearbeitet, bin dann aber zügig ins Homeoffice gewechselt. Anfangs war das hart für meine Familie und mich. Wir haben zwei Kids, drei und fünf Jahre alt, und die Kindergärten waren ebenfalls dicht. Mein Mann ist Polizist, und wenn er Nachtdienst hatte, habe ich vormittags die Kinder betreut und dann nachmittags gearbeitet. Wir hatten aber das Glück, dass wir schon bald die Notbetreuung in den Kindergärten nutzen konnten und die Großeltern sehr geholfen haben.
Alles lief eigentlich gut, aber ich merkte auch irgendwann, dass ich einen Ausgleich zum Homeoffice brauche. Zum Glück leben wir sehr idyllisch, umgeben von Feldern und Wäldern, da konnten wir am Wochenende viele Rad- und Wandertouren unternehmen. Auf der Streuobstwiese meiner Eltern bauten wir mit den Kindern Gemüse an. Die Pflänzchen dafür wurden sogar in meinem Arbeitszimmer gezogen. Wenn wir später als Familie zusammen die Tomaten und Gurken ernten, ist das schon toll! Und auch innen waren wir aktiv: Den Flur und das Kinderzimmer haben wir renoviert. Für Ausgleich haben wir also gesorgt, aber mir ist es trotzdem nicht immer gelungen, wirklich abzuschalten.
Wenn mein Mann frei hatte, holte er die Kinder ab – und an diesen Tagen fand ich manchmal kein Ende im Homeoffice. Nach Feierabend, das merkte ich schnell, ist es wichtig, das Bürozimmer zu verlassen und die Tür hinter sich zu schließen. Dann wird auch der Arbeitsschalter im Kopf umgelegt.
Ich bin generell lieber im Büro. Dass man sich schick anzieht und zur Arbeit fährt, ist so ein Alltagsritual, das mir fehlt. Genau wie meine KollegInnen: Die gemeinsamen Mittagessen oder der Spaziergang mit einigen von ihnen waren immer angenehm ausgleichend. Es fehlt, dass man sich nicht mehr sieht, um sich persönlich auszutauschen. Aber es nützt ja nichts, da muss man in so einer Pandemie durch. Ich helfe mir dann, indem ich mir sage: „So, ich ruf da jetzt an und hör mal, wie es geht.“
Das Interview ist zuerst erschienen im VÖB-Magazin „Gemeinsam Gestalten“.